PAG 2026
StartseiteProgrammAnmeldungTagungsortUnterbringungKontakt
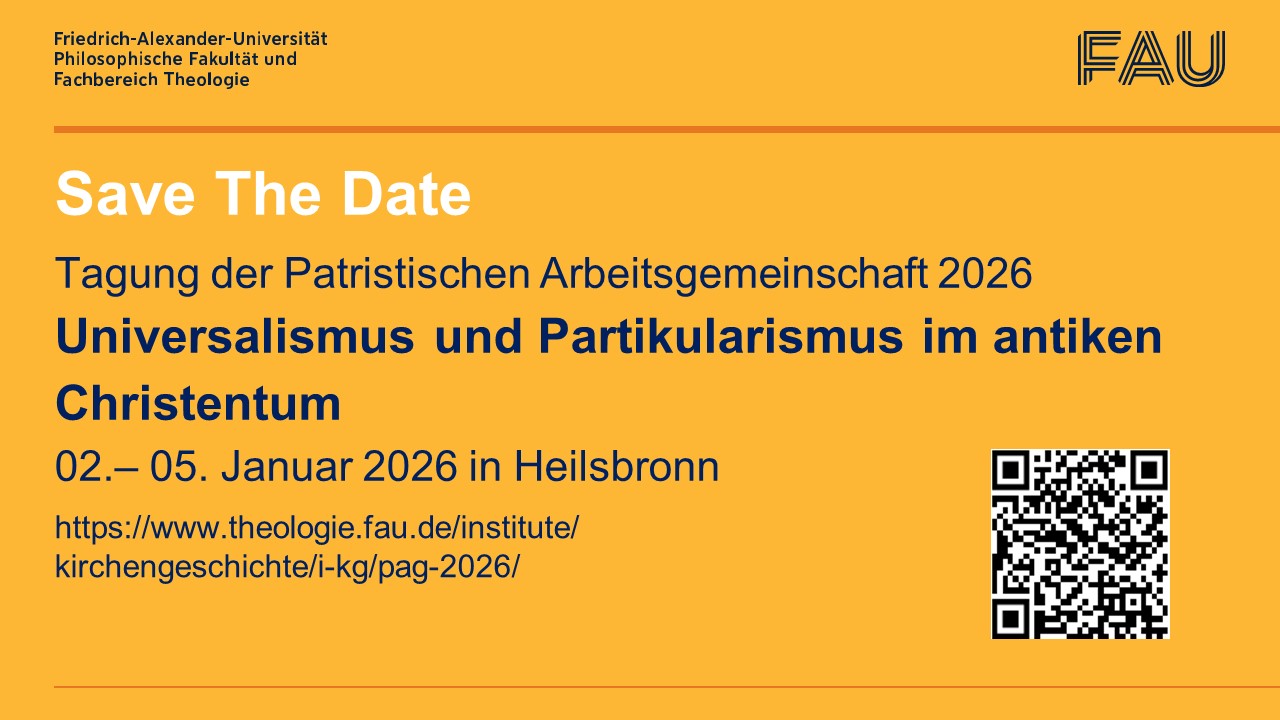
Das Christentum ist seit seinen Anfängen durch die Spannung von universalen Ansprüchen und deren partikularen Entstehungskontexten und Geltungsräumen geprägt. Diese Spannung gehört zu den Grundkonstellationen des Christentums bis heute: ein Evangelium für alle Völker (Mt 28) erreicht nur einen Teil der Menschheit und wird verschieden interpretiert; das Christentum gilt als Weltreligion, existiert aber in Gestalt vieler Kirchen und Gruppen, die unterschiedliche Verbreitungsräume haben und sich zum Teil gegenseitig nicht anerkennen.
Ziel der Tagung ist es, dieses Spannungsfeld für die Kaiserzeit und Spätantike auszuloten. Das ist besonders aufschlussreich, weil in dieser Zeit christliche universale Ansprüche erstmals formuliert und begründet wurden und das unter Bedingungen, die in hohem Maße partikular waren. Kommunikation zwischen Christen über die lokalen Gemeinden, Regionen sowie die Grenzen des Imperium Romanum hinweg bildeten die Voraussetzungen dafür, dass universale Konzepte produziert und universale Ansprüche erhoben oder bestritten werden konnten. Es lohnt sich zu fragen: Welche Personen und Gruppen haben diese Ansprüche formuliert und getragen? Auf welche Weise (d.h. durch welche theoretischen Diskurse, sozialen Praktiken und Medien) wurden diese verbreitet, stabilisiert oder problematisiert? Welche Funktionen erfüllten sie in den konkreten historischen, und das heißt immer auch partikularen, Kontexten? Von besonderem Interesse sind antike christliche Reflexionen zu den Grenzen und Problemen universaler Ansprüche, zum Beispiel in der Auseinandersetzung mit innerchristlicher Pluralität und mit anderen Religionen.
Die Tagung wird organisiert durch Charlotte Köckert (Erlangen), Volker Drecoll (Tübingen), Lisa Haag (Erlangen), Uta Heil (Wien), Charlotte Kirsch-Klingelhöffer (Heidelberg) und Jonathan Stutz (Berlin).